Paläogeographie von Iberia im Karbon vor und während der Variszischen Kollision
MRW Amler
Die Evolution der Ozeane zwischen Laurussia und Gondwana – im Westen zwischen „Südamerika“ und „Nordamerika“ der Theia-Ozean und im Osten zwischen „Europa“ und „Afrika“ der Rheia-Ozean (MCKERROW & ZIEGLER) – und die Kollision von Laurussia und Gondwana werden seit über 30 Jahren kontrovers diskutiert. Verschiedene Meinungen existieren über die Richtung der Kontinentbewegungen, die jeweils sich gegenüber liegenden Regionen und die zusätzlichen Terrane, die in die Kollision verwickelt waren.
Obwohl sich umfangreiche Untersuchungen sowohl mit der Rekonstruktion und Interpretation der plattentektonischen Entwicklung als auch mit der Position von Kontinenten und Spreizung bzw. Subduktion von Ozeanen befassen, konnte bisher kein überzeugendes, widerspruchsfreies Modell für die Position von Iberia vor der Aufnahme in den Pangaea-Kontinent erstellt werden. Bisher existieren Rekonstruktionen, die auf plattentektonischen Analysen, paläomagnetischen Daten und paläobiogeographischen Hinweisen basieren, aber zu unterschiedlichen Positionen von Iberia und umgebenden Ozeanen geführt haben (z.B. Abb. A). Dies betrifft nicht nur die plattentektonische Entwicklung während der Variszischen Kollision, sondern auch die Vorgeschichte Iberias in der Zeit vom späten Proterozoikum bis zum Devon. Aus den unterschiedlichen Untersuchungsansätzen und Schlussfolgerungen ergeben sich nicht nur Unterschiede in Iberias geographischer Stellung und Position innerhalb des Mikrokontinents Armorika (auch: „Armorican Terrane Assemblage“), sondern auch in ihrer Entfernung von Gondwana und Laurussia. Darüber hinaus unterscheiden sich die Modelle in ihrer Orientierung und der tektonischen Rückrotation der heutigen Gebirgsstruktur, die berücksichtigt werden muss, um die ursprünglichen Ablagerungsgebiete rekonstruieren zu können. Schließlich muss dabei noch die Frage mit einbezogen werden, ob und inwieweit Armorika in Relation zum Mikrokontinent Avalonia überhaupt ein eigenständiges Terran (bzw. eine Terran-Gruppierung) bildete und in wie weit Iberia damit verknüpft war. Viele Differenzen zwischen den unterschiedlichen Modellvorstellungen resultieren daraus, dass sich paläomagnetische Daten als unzuverlässig erwiesen haben, spätere Überprägungen bzw. Remagnetisierungen aufweisen oder dass vorhandene Daten unterschiedlich interpretiert worden sind.
 Abb. A: Paläogeographie während des späten Mississippiums. Die Interniden von Iberia sind bereits in das Variszische Gebirge eingebunden, die Kantabrische Zone wird noch vom Vorlandbecken (Kantabrisches Becken, roter Pfeil) gebildet (aus BLAKEY, R., 2004: Regional paleogeographic views of earth history. – jan.ucc.nau.edu/~rcb7/nat.html).
Abb. A: Paläogeographie während des späten Mississippiums. Die Interniden von Iberia sind bereits in das Variszische Gebirge eingebunden, die Kantabrische Zone wird noch vom Vorlandbecken (Kantabrisches Becken, roter Pfeil) gebildet (aus BLAKEY, R., 2004: Regional paleogeographic views of earth history. – jan.ucc.nau.edu/~rcb7/nat.html).
Karbonische Sedimentgesteine und Faunen aus dem Kantabrischen Gebirge Nord-Spaniens bilden ein wichtiges Bindeglied bei der Rekonstruktion der Paläogeographie der westlichen Paläo-Tethys zwischen den Großkontinenten Gondwana und Laurussia unmittelbar vor und während der Variszischen Kollision. Aufbauend auf den Pionieruntersuchungen im Paläozoikum des Kantabrischen Gebirges durch niederländische Kolleginnen und Kollegen in den 1960er Jahren werden vor allem die Feinstratigraphie sowie Faunenbeziehungen von Foraminiferen, Ostracoden, Mollusken, Trilobiten und Brachiopoden innerhalb der Teilareale des Kantabrischen Gebirges (Kantabrische Zone: Asturo-Leonesische Region, Palentinische Region) sowie die phylogenetischen Entwicklungen von Mollusken im Karbon und Perm bis zum Aussterbeereignis an der Perm/Trias-Wende untersucht. Damit sollen zusätzlich zu den plattentektonischen und paläomagnetischen Daten die Ergebnisse zu faunistischen und biofaziellen Beziehungen aussagekräftige Hinweise zur ehemaligen Position einzelner Sedimentationsräume und Kontinentfragmente bzw. ihrer Beziehungen zueinander liefern. Als Ausgangsbasis wurden zunächst die gegensätzlichen Hypothesen und „Modellvorstellungen“ zur paläogeographischen Position von Iberia während der Variszischen Kollision zusammengestellt, um die Grundlage für Faziesrekonstruktionen zu schaffen. Für ein besser passendes Bild der ehemaligen Verteilung von Faziesgürteln musste ein paläogeographisches Bild entworfen werden, das die Krümmung des Asturo-Kantabrischen Bogens in ein mehr oder weniger geradliniges Orogen zurückformt (Abb. B).
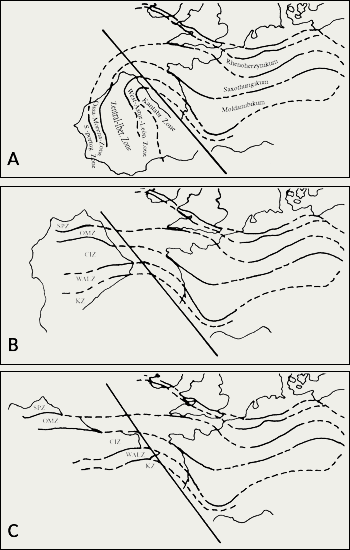 Abb. B: Rückrotation des Iberischen Terrans.
Abb. B: Rückrotation des Iberischen Terrans.
A – Ausgangszustand vor der mesozoischen Öffnung der Biskaya;
B – komplette Rückrotation von Iberia;
C – Entzerrung der iberischen Struktureinheiten westlich der Bay-of-Biscay-Störungszone
(Abbildungsgrundlage aus GURSKY, in: Lexikon der Geowissenschaften, 5. – 301-303; Heidelberg, Spektrum, 2002).
In diese Rekonstruktion wurden bereits publizierte Faziesverbreitungskarten für das späte Tournaisium, das späte Viséum und das späte Serpukhovium zurückrotiert, um sie in die rückorientierte Paläogeographie einzupassen (Abb. C, D). Im Ergebnis liegt ein sich annähernd Ost-West erstreckendes Festland vor, welches das Hinterland des südlich vorgelagerten Kantabrischen Beckens bildet. Im Gegensatz zu den publizierten Karten ist das Kantabrische Becken nun deutlich breiter und greift weniger tief in das Festland ein. Ähnliche Überlegungen hat LEEDER bereits 1987 in einer weitgehend übersehenen Arbeit in mehreren paläogeographischen Karten dokumentiert. Damit wird ein erster Versuch unternommen, die Faziesverhältnisse im iberischen Mississippium mit den tektonischen und strukturgeologischen Ergebnissen in Einklang zu bringen, um z.B. paläobiogeographische Verhältnisse besser verstehen zu können.
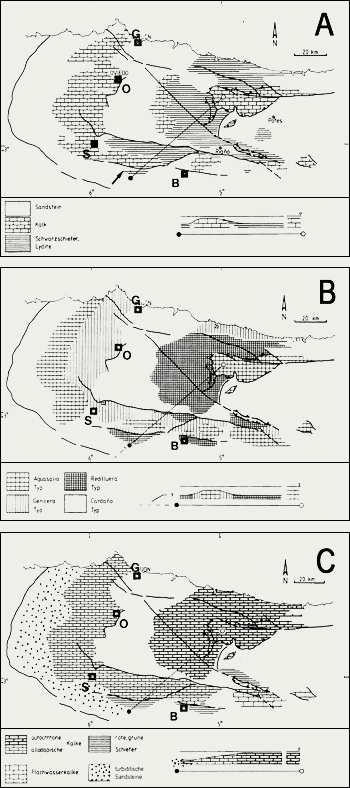 Abb. C: Faziesverteilungskarten des Mississippiums.
Abb. C: Faziesverteilungskarten des Mississippiums.
A – spätes Tournaisium (Vegamián- und Baleas-Formation);
B – spätes Viséum (Genicera-Formation);
C – spätes Serpukhovium (Barcaliente- und Cuevas- bzw. Olleros-Formation).
Bezugspunkte: G – Gijon; O – Oviedo; S – San Emiliano; B – Boñar
(aus EICHMÜLLER, K. & SEIBERT, P., 1984: Faziesentwicklung zwischen Tournai und Westfal D im Kantabrischen Gebirge (NW-Spanien). − Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 135: 163-191, ergänzt).
Aus den Veröffentlichungen von FRANKENFELD, EICHMÜLLER & SEIBERT, EICHMÜLLER, SEIBERT sowie RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ liegen für das frühe Tournaisium (Ermita-Formation), das späte Tournaisium (Vegamián-Formation), das späte Viséum (Genicera-Formation) und das späte Serpukhovium (Barcaliente-Formation) Faziesverbreitungskarten vor. Diese Karten benutzen die heutige Verbreitung der verschiedenen Fazies als Bezugsgrundlage (Abb. C). Um die einzelnen Fazieszonen des Kantabrischen Beckens in das großräumige Bild im Mississippium einzubinden, müssen sowohl die Krümmung des Bogens als auch die Überschiebungen der Struktureinheiten zurückgenommen werden. Im folgenden Schritt wurden die Faziesverbreitungskarten für das späte Tournaisium, das späte Viséum und das späte Serpukhovium von EICHMÜLLER & SEIBERT mit Bezugspunkten versehen. Es handelt sich um die Orte Gijon, Oviedo, San Emiliano und Boñar. In der Fazieskarte des späten Serpukhoviums wurde die Fazies der turbiditischen Sandsteine ergänzt. Im letzten Schritt wurden die Faziesverbreitungskarten in einer ersten Annäherung zurückrotiert, um sie in die rückrotierte Paläogeographie einzupassen. Dabei musste auch in erster Annäherung die Verkürzung der Faziesgürtel berücksichtigt werden. Im Ergebnis erscheinen mehr oder weniger küstenparallele Faziesgürtel, die in zukünftigen Rekonstruktionen auf Karten in einem deutlich vergrößerten Maßstab dargestellt werden müssten (Abb. D).
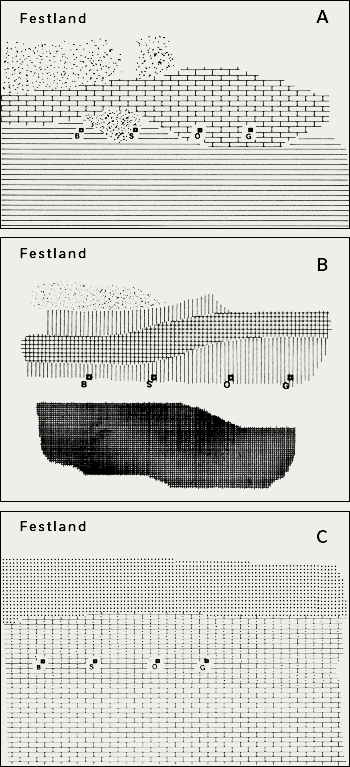 Abb. D: Hypothetische rückrotierte und entzerrte Faziesverbreitung im Mississippium des Kantabrischen Beckens.
Abb. D: Hypothetische rückrotierte und entzerrte Faziesverbreitung im Mississippium des Kantabrischen Beckens.
A – spätes Tournaisium (Vegamián- und Baleas-Formation);
B – spätes Viséum (Genicera-Formation);
C – spätes Serpukhovium (Barcaliente- und Cuevas- bzw. Olleros-Formation).
Bezugspunkte: G – Gijon; O – Oviedo; S – San Emiliano; B – Boñar.
Die Rekonstruktion der Faziesverbreitung für das späte Tournaisium führt zu einem küstenparallelen Gürtel von sandigen Ablagerungen, dem die bioklastischen Baleas-Kalke meerwärts vorgelagert waren. In einigen 10er Kilometern Distanz von der Küste breitete sich die eigentliche Beckenfazies der Vegamián-Schiefer aus. Die Faziesverteilung für das späte Viséum entspricht dem Faziesschnitt von EICHMÜLLER & SEIBERT, allerdings dürften die Faziesgürtel deutlich breiter gewesen sein, als von den Autoren vermutet. Die Aguasalio-Fazies bildete einen schmalen, submarinen Schwellenzug, der die Redilliera-Beckenfazies von der Küstenregion trennte. Während des späten Serpukhoviums war das Becken weitgehend von autochthonen mikritischen Karbonaten beherrscht; zum Festland hin folgte ein Gürtel aus feinstkörnigen, bioklastischen Kalken (allodapische Kalke), während dem Festland vorgelagert eine Rinne mit turbiditischen Siliziklastika folgte.Im Ergebnis bleiben noch viele Fragen offen. Dazu gehört u.a. die Ausrichtung des Kontinentes bzw. Gebirges und die Frage, ob das Kantabrische Becken nach Süden oder nach Südosten hin ausgerichtet war. Des Weiteren klärt die Rekonstruktion nicht, in wie weit die Beziehungen des Kantabrischen Faziesraumes mit dem mitteleuropäischen Kulm-Becken tatsächlich existierten oder ob nur analoge Faziesbedingungen geherrscht haben. Weitere Schwerpunkte des Forschungsprojektes sind unter „Beckenanalyse“ dargestellt.
Mitarbeiter
J. Kühn, S. Prasser
Vernetzung
u.a. Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Köln, Universität Kiel, Naturalis Leiden, Universität Oviedo.
Präsentation von Ergebnissen
Tagungen in Zürich (1998), Coburg (2000) und Frankfurt/M. (2001).
Publikationen über das Forschungsprojekt
AMLER, M.R.W. (2000): Paläobiogeographie von Iberia im Karbon. − Progr. 70. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft in Coburg. – Terra Nostra 00/3: 18; Berlin (Vortragskurzfassung).

